„A to B“ nennt sich die kleine Fotoserie des Fotografen Espen Eichhöfer, die er 2013 anlässlich des Umzugs der Galerie c/o Berlin produzierte: Menschen am Bahnhof Zoo, Unterwegssein, Momente des Übergangs, die Großstadt als permanenter Transit. Ein schönes Projekt, das jetzt zum Auslöser eines Rechtsstreits wird, der nicht nur mal eben die Fotografie als Kunst- und Dokumentationsform gefärdet, sondern womöglich auch unser aller Möglichkeit, visuell miteinander zu kommunizieren und obendrein auch noch unser Verständnis von Öffentlichkeit. Nein. Eine Nummer kleiner geht es nicht.
Usprünglich war das Foto einer Frau im Leopardenmantel Teil der „A to B“-Serie. Als die abgebildete Dame jedoch davon erfuhr, dass sie Objekt einer Fotoausstellung war, verklagte sie den Fotografen und die Galerie auf jeweils 4.500 Euro Schmerzensgeld. Das Landgericht Berlin lehnte die monetäre Forderung zwar ab, befand jedoch, dass Eichhöfer mit seinem Foto das Persönlichkeitsrecht der Frau verletzt hatte. Das Bild darf nun nicht mehr gezeigt werden.

Auch diese Dame wollte vermutlich nicht fotografiert werden. Zumindest entnehme ich das ihrem Blick. Im Dienste der Kunst habe ich ihren Wunsch jedoch ignoriert.
Mit diesem Urteil sehen viele Vertreter der Foto- und Kunstwelt das Genre der künstlerisch-dokumentarischen Straßenfotografie in Gefahr, denn die lichtet traditionell Menschen in ihrer natürlichen Umgebung ab.
Lutz Fischmann, Geschäftsführer des Fotografenverbandes Freelens sagt dazu in der Berliner Zeitung:
„Man kann sicherlich behaupten, dass alle wichtigen Fotografien der letzten 175 Jahre, auf denen Menschen abgebildet sind, ohne die notwendige Einwilligung der abgebildeten Personen entstanden sind. Es sind allesamt Ikonen der Fotografie – ohne sie wäre unsere Welt ärmer und wir würden viele Geschehnisse heute nicht mehr verstehen und darstellen können, hätten wir diese Fotos nicht.“
Eichhöfer in der gleichen Zeitung:
„Für nachfolgende Generationen wäre es dann nicht mehr möglich, zu sehen, wie das Leben auf der Straße 2015 aussah.“

Mit einem einzigen Schuss gleich drei Persönlichkeitsrechte verletzt. Aber: Wen hätte ich fragen sollen? Das Kind? Oder auf seine Eltern warten? In dieser Zeit wären natürlich die beiden Personen auf der Rolltreppe entwischt – aber das wären sie auch so. Kurz: Dieses Foto konnte nur unter Missachtung des geltenden Rechts entstehen.
„Frag doch vorher“ oder „frag doch hinterher“, lauten die beiden Standardratschläge, die einem unsichtbaren Fotografiedebattennaturgesetz folgend, immer wieder von irgendjemandem in den Raum geworfen werden. Sie sind beide nicht realisierbar. Der letztere aus praktischen Gründen nicht: In der Straßenfotografie gelangt man in der Regel nur über den Umweg der Quantität zur Qualität. Nach einem Fotografiertag auf der Straße kann es durchaus sein, dass man ein paar hundert Bilder auf der Speicherkarte mit nach Hause bringt, von denen man nach langwieriger Sichtung vielleicht ein oder zwei als einigermaßen gelungen betrachtet. Soll man als Fotograf also allen Ernstes vorsorglich hunderte von schriftlichen Verwertungsgenehmigungen einholen, inklusiver der damit verbundenen Erklärarbeit; all das für Fotos, die man dann sowieso niemals für irgend etwas verwendet?
Und warum der „Frag vorher“-Ratschlag nicht funktioniert, das versteht auch jeder Nicht-Quantenmechaniker: weil die Objekte der Beobachtung durch die Gewahrwerdung ebendieser ihr Verhalten ändern. Damit ist der dokumentarische Wert des Fotos verloren. Oder anders ausgedrückt: Wenn Menschen wissen, dass sie fotografiert werden, dann grinsen sie dämlich.

Immer wieder ein interessantes Phänomen: Mit Hilfe einer gewöhnlichen Fotokamera lässt sich die Natürlichkeit der Fotografierten auf nahe null herunterfahren.
Espen Eichhöfer möchte nun ein Grundsatzurteil erstreiten und sammelt für die zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten auf Startnext. Auch wenn er das Ziel von 14.000 Euro bereits erreicht hat, sollte man ihn darüber hinaus unterstützen: So ein Rechtsweg kann langwierig und teuer sein.
Link: https://www.startnext.com/streetphotography
All das betrifft erstmal nur die Straßenfotografie. Und wer mag, kann all das natürlich als eine Orchideen-Diskussion abtun („Habt Ihr denn keine anderen Probleme!!11!drölf!??“). Aber der Fall Eichhöfer zeigt exemplarisch, wie kleinteilig – man könnte auch sagen: wie komplett kaputt – Recht und Gesetz im Bereich der Fotografie in der Öffentlichkeit sind.

Fotos in und von der Öffentlichkeit: eine vermeintlich kleine Debatte, die jedoch einen langen Schatten wirft (Aus der Reihe: Bildunterschriften wie aus der Kreiszeitung.)
Wer auf der Straße eine Kamera zückt, der versinkt prompt bis mindestens zum Auslöser in eine juristische Sumpflandschaft. Er bekommt es mit Persönlichkeitsrechten zu tun, mit Urheberrechten, mit Pressefreiheit, mit Kunstfreiheit – und mit deren jeweiligen Abwesenheiten: Ist die Person auf dem Bild erkennbar oder ist sie nur Beiwerk des Gebäudes dahinter? Unabhängig davon: Darf man das Gebäude überhaupt fotografieren? Und jene Person? Ist sie vielleicht eine der Zeitgeschichte? Immerhin hat sie ja ein Blog, glaube ich, oder? Was ist mit Demonstrationen? Mit Straßenfesten? Mit Konzerten? Wie verhält sich das Recht in Einkaufszentren? In Museen? Auf Sportplätzen? In der U-Bahn?
Um die Sache noch zu verkomplizieren, unterscheidet das geltende Recht zwischen der Aufnahme eines Fotos und seiner Veröffentlichung: Wer sich zu Unrecht fotografiert fühlt, der darf vom Fotografen nicht – wie oft fälschlich angenommen – die Löschung dieses Bildes verlangen, sondern lediglich dessen Nichtveröffentlichung. Im Internet-Zeitalter ein eher theoretisches Recht.
Und weil das alles offenbar noch nicht ausreicht, den simplen Vorgang eines Fotoschusses auf das Kompliziertheitsniveau einer diplomatischen Depesche von Süd- an Nord-Korea zu heben, hat die Koalitionsregierung jüngst im Empörungswindschatten der Edathy-Affäre einen juristischen Schrotschuss abgefeuert, von dem jetzt noch gar nicht abzusehen ist, wie groß der Schaden für den fotografierenden Teil der Bevölkerung sein wird. So heißt es im neuen § 201a Abzatz 2, dass künftig bestraft wird,
„… wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person zugänglich macht.“
Unschärfere Formulierungen konnte der Gesetzgeber offenbar gerade nicht auftreiben: Fügen also beispielsweise die getwitterte Aufnahmen einer betrunkenen Person dem Ansehen ebendieser erheblichen Schaden zu? Auch im Karneval? Was ist mit Menschen, die sich auf Fotos einfach schlecht getroffen fühlen? Die sich auf Bildern zu dick, zu alt, zu hässlich finden?

Fügt dieses Foto dem Ansehen der darauf abgebildeten Person Schaden zu? Vielleicht sogar erheblichen? Wer entscheidet das? Ein Anwalt? Ein Richter? Die Person selbst?
Auf Spiegel Online stellt der Medienrechtsanwalt Thorsten Feldmann die Frage nach einer Auswirkung dieses seltsamen Schnellschussgesetzes auf die Berichterstattung über Zeitgeschichte:
„Dürften Medien noch immer das berühmte Hitlergruß-in-durchnässter-Jogginghose-Foto aus Rostock-Lichtenhagen veröffentlichen? Das stellt den Fotografierten ja in jedem Fall bloß.“
Zurück zu unserem Fotografen auf der Straße: Bevor der nun auf den Auslöser drückt, muss er sich als gesetzestreuer Bürger eigentlich all diesen genannten juristischen Klumpatsch durchs Hirn gehen lassen. Bleibt die Frage, wozu es Kameras mit immer schnellerem Autofokus gibt, wenn der Fotograf doch sowieso vor jedem Foto Stunden der Gesetzesmeditation in Paralyse verbringt.

Dieser Fotograf überlegt seit dreieinhalb Tagen, ob der Schnappschuss, den er vorhat, juristisch einwandfrei ist
Diese undurchsichtige und unabwägbare Rechtslage führt im Alltag zu einer Art gefühltem Recht. Der öffentliche Raum quillt über vor Aussagen, nein, meistens eher Ausrufen wie: „Du darfst hier nicht fotografieren“, „Du darfst mich nicht fotografieren“, „Du darfst mein Kind nicht fotografieren“, „Du darfst mein Haus nicht fotografieren“, „Du darfst mein Auto nicht fotografieren“, „Du darfst meinen Hund nicht fotografieren.“ Das ist zwar meistens Bullshit, aber darüber darf man sich nicht wundern: Wo die Eindeutigkeit fehlt, da wuchert die Esoterik.

Mensch mit Massenmedium: Wie das geltende Recht sich die Rezeption einer Veröffentlichung vorstellt
Aber es ist in Wahrheit alles noch viel schlimmer: Alle oben angesprochenen Gesetze, Rechte, Regelungen, Stolperfallen und Tretminen stammen noch aus der vordigitalen Zeit, aus einer Ära, als die „Veröffentlichung“ eines Fotos noch „Zeitung“ oder „Zeitschrift“ bedeutete, als sie die Ausnahme war und nicht die Regel. Aus einer Zeit, als noch nicht jeder Mitmensch eine Fotografiermaschine mit eingebauter Publikationstaste permanent in den Händen hielt.
Fotografie im Jahre 2015 ist viel mehr als Kunst, als Dokumentation oder als Journalismus – Fotografie ist Kommunikation. Menschen schießen Selfies und mailen sie im gleichen Moment an Freunde, oder sie kleben sie an ihre Facebook-Wand. Sie fotografieren sich in Umkleidekabinen und sie lassen ihre Freunde mitentscheiden, ob ihnen die Kleidung steht. Sie fotografieren Konzertplakate als Gedächtnisstützen und ihr Mittagessen einfach nur so. Sie knipsen U-Bahn-Haltestellen und die dort Wartenden für Instagram, U-Bahn-Mitfahrer für Twitter, Katzen in der U-Bahn für Facebook und sie veröffentlichen den U-Bahn-Fahrplan auf Flickr, für ihre Freunde, die nächste Woche zu Besuch kommen. Ob dabei irgendwelche Personen mit auf den Bildern zu sehen sind und wie groß oder klein – Kollateralmotive sozusagen: who cares?
Fotos zu publizieren, für kleine oder größere Öffentlichkeiten, ist 2015 so alltäglich wie die Ich-komme-etwas-später-SMS es 1995 war. Wer mag, darf jetzt eine Gerätegeneration weiterdenken, in Richtung Datenbrillen und sonstiger Wearables, die schon bald so selbstverständlich sein werden, wie es heute Smartphones sind. Sie bringen mit: Fotos per Sprach- oder Augenblinzel-Steuerung und wer weiß was noch.
Und dann wären da auch noch Lifelogging-Devices, kleine ansteckbare Geräte, die automatisch den Alltag des Nutzers in Fotoserien dokumentieren – und diese ins Web laden. Willkommen in der Ära der Dauerfeuer-Fotografie-Publikation.
Fotografie ist Kommunikation. Jede Regel, jedes Gesetz, das heutzutage Fotografie im öffentlichen Raum betrifft, betrifft unser aller Kommunikationsvermögen. Fotografieverbot heißt somit Kommunikationsverbot oder metaphorisch: Sprechverbot. Zur Erinnerung: Wir reden hier über den öffentlichen Raum, einen Ort, der eigentlich ein Ort des Austausches, der Kommunikation sein sollte.
Ich bin davon überzeugt, dass in Sachen Fotografie im öffentlichen Raum all das rechtliche Gezerre um Kunst- und Pressefreiheit auf der einen Seite und um Urheber- und Persönlichkeitsrecht auf der anderen um Lichtjahre zu kurz greift. Nur Juristen freuen sich über solch ein bröseliges Ordnungssystem, das ihnen immerzu neue Einzelfälle beschert, über einen Rahmen, in dem sie allein entscheiden dürfen, was denn nun Kunst ist, wie weit das öffentliche Interesse heute mal gehen darf, welche Intention wahrscheinlich mit einer bestimmten Fotografie verbunden war und wie akzeptabel das Ablichten einer Person genau dann ist, wenn sie drei Zwölftel eines Bildes ausfüllt. Juristen finden das toll, denn davon leben sie schließlich. Bürger können dabei nur verlieren: Zeit, Nerven und Geld.
Wir werden im Laufe dieses Jahrzehntes nicht darum herum kommen, klar zu definieren, was uns als Gesellschaft der öffentliche Raum bedeutet und wie öffentlich wir ihn denn gerne haben wollen. Die Fotografie-Debatte ist dafür ein hübscher Auftakt.
Wenn jeder einzelne Bürger seine Privatsphäre mit nach draußen nimmt und erwartet, dass sie dort unberührt bleibt, dann ist der öffentliche Raum nicht öffentlich, und dann ist es auch kein Raum, sondern allerhöchstens ein Strom aus einzelnen Privatschollen.
Wenn wir einerseits Überwachungskameras im öffentlichen Raum akzeptieren, andererseits fotografierende Menschen aber nicht, wenn wir also gefühlte Sicherheit über gelebte Kommunikation stellen, wenn wir mithin Kameras zwar als Abschreckung zulassen, als Kunst- und Kommunikationswerkzeuge jedoch nicht, dann sind wir gesellschaftlich auf einer ziemlich schiefen Spur.
Zurück zum Anfang: In den klagefreudigen USA wäre ein Fall wie der von Espen Eichhöfer undenkbar: Dort darf man jeden Menschen fotografieren, der sich im öffentlichen Raum aufhält. Einfach so. Mir ist nicht bekannt, dass diese Regelung dort zu irgendwelchen nennenswerten, gesellschaftlich negativen Auswüchsen geführt hätte. Nur mal als Gedankenanstoß.
Zum Thema:
- Espen Eichhöfer
- Startnext: Streetphotography Now
- Berliner Zeitung: Heimlich fotografierte Passantin verklagt Künstler auf Schmerzensgeld
- ARD, ttt: Das Ende der künstlerischen Straßenfotografie?
- Deutsche Anwaltsauskunft: Droht das Ende der Straßenfotografie?
- Freelens: Streetphotography muss weiterhin möglich sein
- Spiegel Online: Gesetzesänderung nach Fall Edathy – Welche Fotos darf man jetzt noch machen?
- NOFAC.ES
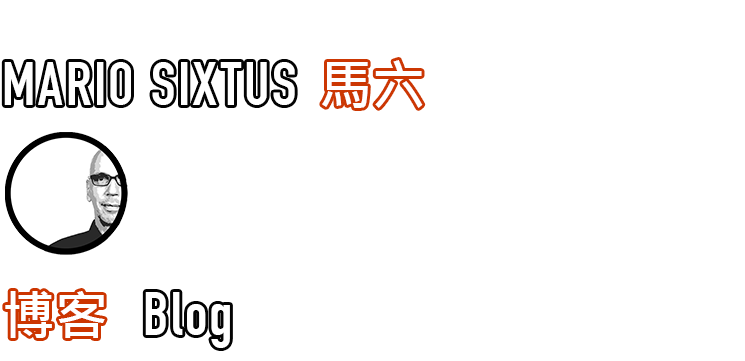







Pingback: Lesetipp | Kreative Strukturen
Pingback: Dentaku » Über Fotografie, Kommunikation, dämliches Grinsen und den öffentlichen Raum
Pingback: Sammelmappe » Blog Archive » Den öffentlichen Raum zurückgewinnen
Pingback: Markierungen 02/25/2015 - Snippets
Pingback: 25. Februar 2015 › kwerfeldein - Fotografie Magazin | Fotocommunity
Pingback: Fotografie im öffentlichen Raum | mynethome.de
Pingback: Exkurs: Kompetenter Umgang mit Bildern - Arbido Projektmanagement
Pingback: Weekly Leseempfehlung vom 27. February 2015 | off the record
Pingback: diese Woche … (1509) - Tom! Striewisch
Pingback: Woanders – diesmal mit der Straßenfotografie, Manfred Maurenbrecher, Banksy und anderem | Herzdamengeschichten
Pingback: Montagslinks 08/15 | Random Signals
Pingback: Fotografieverbot heißt Kommunikationsverbot | Luminance
Pingback: Linktips Roundup 3th March 2015 | Freiraum
Pingback: Street Photography: Prozess um Fotos im öffentlichen Raum per Crowdfunding finanziert | Newswire Basic-One