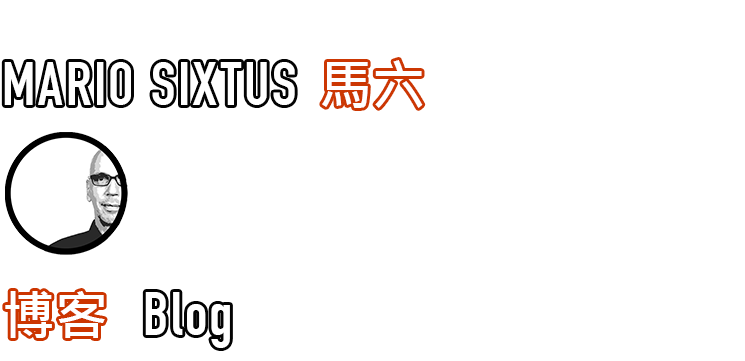Auf dem Campingtisch vor ihr schwimmen in einer Wasserschüssel daumenlange Bananenstücke. Daneben stehen ein paar Plastikbecher voll Wasser bereit. Sie ist vielleicht 50 und deutlich übergewichtig. Ihre Haare hat sie unter eine Wollmütze gezwängt, trotz der Wärme. Sie trägt etwas sackartiges Dunkelrotes.
Es muss ungefähr der 34. Kilometer des Marathons sein. Ich bin noch nie zuvor so weit gelaufen. Auch im Training nicht. Meine Füße schmerzen, mein Rücken schmerzt, mein Pulsschlag stampft in meinen Ohren, ich hechele wie ein Hund. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich möchte nicht mehr laufen, nie mehr. Ich möchte auf der Stelle stehen bleiben und dann den Rest meines Lebens sitzend in einem gemütlichen Campingsessel verbringen, so wie die übergewichtige Frau in dem dunkelroten Sack hinter dem Tisch mit den schwimmenden Bananen.
Die Waller Street gehört zu den eher unaufgeregten Ecken San Franciscos. Gepflegte Einfamilienhäuser, gehobene Mittelklasse, ab und zu sieht man einen geparkten Sportwagen, genau so häufig wie einen Familienkombi. Wer hier wohnt, hat es wahrscheinlich geschafft, finanziell. Ein paar der Anwohner haben Tische auf die Straßen gestellt und verköstigen die Marathonläufer, zusätzlich zu den offiziellen Proviantierungsstellen. Die Waller-Streeter reichen den Laufenden Obst, Wasser, Cola und irgendwelches grellfarbenes Süßgebäck, das man sich wohl nur traut, in den Mund zu stecken, wenn man in den USA aufgewachsen ist.
Ich fingere ein Bananenstück aus der Wasserschale und schlinge es fast ohne zu kauen hinunter. Dann noch eins. Die Frau lächelt und nickt mir unter ihrer Wollmütze zufrieden zu. “Thank you”, nuschele ich und greife zu einem der Wasserbecher.
“No”, sagt sie und schaut mich dabei ernst an. “I thank you!” Ich bin irritiert und muss wohl auch so aussehen, denn sie wiederholt es laut und mit überdeutlicher Artikulation: “I thank you!”
Ich trabe weiter. Die Füße schmerzen immer noch, der Rücken schmerzt immer noch, aber die Banane und das Wasser tun gut und beruhigen meinen Körper ein wenig. Ich bin ein langsamer Läufer, und um mich herum laufen die anderen langsamen Läufer. Wir laufen fast ganz am Ende des Feldes. Die durchtrainierten Sportmenschen sind längst im Ziel, die Profis noch viel länger. Wer jetzt noch bei Kilometer 34 herumläuft, gehört zu den Anfängern, zu den Alten, zu den Rekonvaleszenten, zu denen, die eine Wette verloren oder mit dem Schicksal einen Deal geschlossen haben.
“I thank you”, echot es in mir.
In Sichtweite müht sich eine kleine, vielleicht dreißigjährige Frau von Schritt zu Schritt. Sie hat eine Glatze, und ihr Trainingsanzug flattert lose um ihren dürren Körper. Ein paar Meter hinter ihr ist ein älterer Mann unterwegs. Bestimmt Mitte achtzig. Er läuft unrund, bewegt sich asymmetrisch, macht mit dem rechten Bein längere Schritte als mit dem linken. Ich wundere mich, wie er mit diesem Laufstil überhaupt 34 Kilometer weit kommen konnte. Ich selbst habe vor zehn Monaten mit dem Laufen angefangen, nachdem ich 32 Jahre lang jeden Tag etwa 60 Zigaretten geraucht hatte. Es war ein kalkulierter Wechsel: Ich wollte eine tödliche Sucht durch eine gesunde ersetzen. Das war mein Deal.
“I thank you”, hat sie gesagt. Sie dankt mir.
Hier steht nicht mehr so viel Publikum herum wie beim Start an der Embarcadero, der Uferpromenade. Ab und zu ein Grüppchen mit Schildern und lärmerzeugenden Gegenständen. Eine junge Frau hält eine Pappe hoch, mit der Aufschrift “Go, totally random stranger, go!”
“I thank you”, hat die übergewichtige Frau zu mir gesagt. Und es ist ihr offenbar sehr ernst damit.
“God bless you!” steht auf einem Pappschild, das irgend jemand an einem Stoppschild befestigt hat. Ich bin kein religiöser Mensch. Ich hatte schon als Kind Probleme mit den unlogischen Konzepten, aus denen Religion gebaut ist. “Jesus ist für unser aller Sünden gestorben”, hatte der Religionslehrer gesagt, das sei einer der wichtigsten Grundpfeiler des Christentums. Ich fragte den Religionslehrer, wie Jesus denn für meine Sünden gestorben sein könnte, etwa 2.000 Jahre, bevor ich diese überhaupt begehen konnte. Ist Jesus also – quasi im Vorhinein – für alle Sünden gestorben, die jemals von irgendjemandem noch begangen werden können, wollte ich wissen. Wenn ja, dann könnte ich ja in Zukunft so viel Sünden begehen, wie ich wollte, schließlich sei Jesus dafür ja schon stellvertretend gestorben, folgerte ich. Der Religionslehrer teilte meine Folgerungen nicht, konnte mir aber auch nicht erklären, was an meinen Gedankengängen falsch sein sollte.
Was mir damals schon klar war: Jesus ist ebensowenig für meine Sünden gestorben wie Neil Armstrong für mich über den Mond gelaufen ist. Auch wenn dessen Ausspruch – ein großer Sprung für die Menschheit – nahe legen soll, er sei stellvertretend für jeden einzelnen Menschen durch den Mondstaub gehüpft. Das ist er nicht. Er war da. Ich nicht.
“I thank you” hat die übergewichtige Frau zu mir gesagt, denn sie lässt mich für sich den Marathon laufen, an ihrer Stelle. Dafür gibt sie mir Bananen und ein Dankeschön. Dafür kann sie in ihrem Campingsessel sitzen, auf der Waller Street, mit einer Wollmütze auf dem Kopf und in einem unförmigen dunkelroten Dings. Das ist ihr Deal mit der Welt, mit mir.
Kilometer 35. Der ältere Mann mit dem unrunden Laufstil wird unvermittelt schneller und droht, aus meinem Blickfeld zu entschwinden. Ich versuche, mit ihm Schritt zu halten. Meine Füße schmerzen, mein Rücken schmerzt, mein Pulsschlag stampft in meinen Ohren, ich hechele wie ein Hund. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ganz so, als seien die Banane und das Wasser eine Fata Morgana gewesen. Ich möchte einfach nur immer weiter laufen.